 |
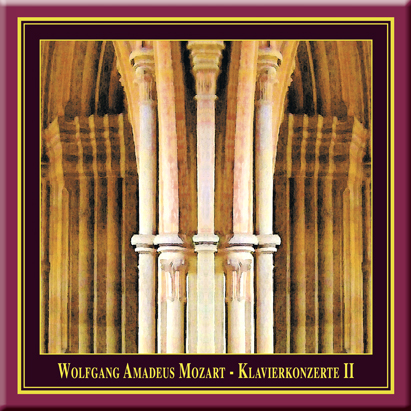 |
 |
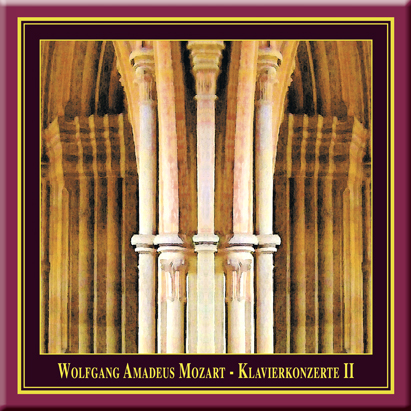 |

|
Wolfgang Amadeus Mozart Christoph Soldan - Klavier Ein Konzertmitschnitt aus der Klosterkirche Titelbild: Josef-Stefan Kindler, 2001 Audio CD, DDD, Spielzeit: ca. 60 Mininuten, |
|
"Ein kraftvoller Mozart, stilistisch auf der Höhe der Zeit - |
|
Christoph Soldan, der bei Prof. Eliza Hansen sowie Christoph Eschenbach an der Hamburger Musikhochschule studierte und seinen internationalen Durchbruch durch eine Tournee mit Leonard Bernstein im Sommer 1989 erlangte, konzertiert hier mit der traditionsreichen Schlesischen Kammerphilharmonie Kattowitz, gegründet im Polen der Nachkriegszeit um 1945. Das Kammerorchester, bestehend aus den Solopositionen der Philharmonie, existiert in dieser Form seit 1981 und wird von der Fachpresse als „höchst präzise, musikantisch und voll jugendlichem Elan" charakterisiert. So musiziert(e) das Orchester mit solch bedeutenden Künstlern wie Zubin Mehta, Arthur Rubinstein oder Krystian Zimerman. Dieses künstlerische Potential kommt sowohl den Interpretationen Soldans als auch dem musikalischen Konzept des Dirigenten Pawel Przytocki sehr entgegen und beleuchtet Mozarts Klavierkonzerte in C- und D-Dur von einer ganz neuen Seite. Przytocki, der wie Soldan auf eine lange internationale Karriere zurückblicken kann (Budapest Concert Orchestra, Orchestra Sinfonica de Xalapa Mexico, Real Philharmonia de Galicia Spanien, Radiosinfonieorchester Krakau), legt dabei grössten Wert auf rhythmische Präzision und akustische Transparenz. Ein Anliegen, das besonders in dem in Mozarts Schaffen neuartigen, groß und virtuos angelegten Eingangssatz des C-Dur Klavierkonzerts aus dem Jahre 1785 seine Entsprechung findet. Mozart gab dabei bestimmte Aspekte eines Plans auf, dessen er sich für die Konzerte aus dem Jahr 1784 bedient hatte. Jedes Konzert dieser Gruppe hatte er mit einem klar gegliederten Thema begonnen, das der Solist bei seinem ersten Einsatz oder unmittelbar danach vortrug. Das C-Dur Konzert beginnt nun mit musikalischem Material, das sich für den Vortrag durch das Klavier nicht eignet, was zwangsläufig zu einer neuen Form des Zusammenspiels von Solist und Orchester führt. Den Abschluss dieser Aufführung bildet eines der wohl beliebtesten Klavierkonzerte Mozarts - das Klavierkonzert in D-Dur aus dem Jahre 1788. Mozart hat es 1790 während der Feierlichkeiten zur Krönung Leopolds II. in Frankfurt uraufgeführt, was dem Werk, wohl auch aufgrund seiner vollmundigen ungetrübten Festlichkeit, den Beinamen „Krönungskonzert" einbrachte. Die große Bläserbesetzung versteht sich allein aus dem herausragenden Anlass, für den an Mitteln nicht gespart worden war. Von der Klavierpartie liegt keine authentische Fassung aus der Uraufführung vor, da Mozart das vorhandene Script während der Aufführung in Frankfurt durch Improvisationen und Verzierungen ergänzt hat. |
|
1. Konzertbeginn Wolfgang A. Mozart |
|
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 467 Das Klavierkonzert D-Dur, KV 537 Ulrich Kiefner |